Der Blick zum nächtlichen Sternenhimmel hat zu allen Zeiten die Menschheit fasziniert.
Spürt jeder doch sofort das Mystische, die
Unendlichkeit, die Unnahbarkeit der himmlischen Sphäre.
Gleichzeitig
wird der Wunsch wach, mehr über das Universum und die Abläufe am Himmel
zu erfahren.
Das ist der erste Schritt zur Astronomie!
Astronomie als Hobby ist erst einmal Naturbeobachtung und verlangt vor allem Geduld und Ausdauer.
Aber warum jetzt noch digitale Astrofotografie?
Viele Objekte am Nachthimmel zeigen ihre Strukturen und Farben erst auf lang belichteten Aufnahmen.
Unser Auge kann nur den momentanen Lichtstrom erfassen. Der CCD-Chip
einer Astrokamera kann Photonen über eine längeren Zeitraum sammeln.
Der einfallende schwache Lichtstrom wird über die Zeit gespeichert und aufsummiert.
Für mich ist Astrofotografie die Herausforderung das "Unsichtbare sichtbar" zu machen.
Beispiel: Orion-Nebel M42, der Star am Winterhimmel
 |
 |
| visuell |
fotografisch |
Der Unterschied zwischen den beiden Bildern besteht darin, daß
eine Kamera, im Gegensatz zum Auge, das einfallende Licht über einen Zeitraum aufsummieren kann. Nur mit lang
belichteten Aufnahmen lassen sich die Formen, Strukturen und Farben der
Himmelsobjekte darstellen.
Objekte für die Astrofotografie
Objekte innerhalb unseres Sonnensystems:
Sonne, Planeten, Monde, Kometen
Saturn:
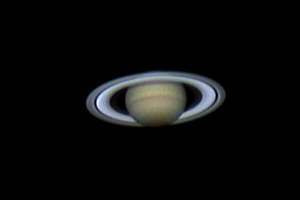 Saturn als zweit größter Planet im Sonnensystem gehört
zu den Gasplaneten. Er ist der sonnenfernste Planet,
der noch mit bloßem Auge gesehen werden kann und war schon im
Altertum bekannt. Als
Herr der Ringe ist er der bekannteste aller Planeten. Die erste
Live-Beobachtung im Fernrohr wird man so schnell nicht vergessen. Es
ist unglaublich, die Kugel des Saturns schwebt scheinbar
schwerelos in seinem Ring. Absolut edel! Der Planet hat was, er hat Stil!
Sein fahles, gelbliches Licht ist bereits ca. 1,5 Stunden zu uns
unterwegs. Ein Saturnjahr - Umlaufdauer um die Sonne - dauert 29
Erdjahre. Dagegen dauert ein Saturntag - Rotationsperiode - nur 10
Erdstunden. Seine mittlere Dichte beträgt 0,7 und ist
somit leichter als Wasser. Seine Oberflächentemperatur
beträgt -180°C. Das Ringsystem ist nur mehrere hundert Meter dick, liegt in seiner
Äquatorebene und besteht aus einer Vielzahl von kleinen Gesteins-
und Eisbrocken. Das Ringsystem ist schon in kleineren Fernrohren ab 40-facher Vergrößerung zu sehen.
Saturn als zweit größter Planet im Sonnensystem gehört
zu den Gasplaneten. Er ist der sonnenfernste Planet,
der noch mit bloßem Auge gesehen werden kann und war schon im
Altertum bekannt. Als
Herr der Ringe ist er der bekannteste aller Planeten. Die erste
Live-Beobachtung im Fernrohr wird man so schnell nicht vergessen. Es
ist unglaublich, die Kugel des Saturns schwebt scheinbar
schwerelos in seinem Ring. Absolut edel! Der Planet hat was, er hat Stil!
Sein fahles, gelbliches Licht ist bereits ca. 1,5 Stunden zu uns
unterwegs. Ein Saturnjahr - Umlaufdauer um die Sonne - dauert 29
Erdjahre. Dagegen dauert ein Saturntag - Rotationsperiode - nur 10
Erdstunden. Seine mittlere Dichte beträgt 0,7 und ist
somit leichter als Wasser. Seine Oberflächentemperatur
beträgt -180°C. Das Ringsystem ist nur mehrere hundert Meter dick, liegt in seiner
Äquatorebene und besteht aus einer Vielzahl von kleinen Gesteins-
und Eisbrocken. Das Ringsystem ist schon in kleineren Fernrohren ab 40-facher Vergrößerung zu sehen.
Objekte außerhalb unseres Sonnensystems, sog. Deepsky-Objekte:
Reflexionsnebel:
Plejaden, Siebengestirn, M45,
Sternbild Stier,

Zwischen den Sternen befinden sich interstellare Staub- und Gaswolken
insbesondere aus Wasserstoff in extrem geringen Dichten. Die
interstellaren Wolken können trotzdem beobachtet werden, weil
enorm große Räume von ihnen erfüllt sind. Befinden sich
genügend lichtbrechende Staubteilchen in der Nähe von jungen
heißen Sternen, so bilden sich bläulich strahlende
Reflexionsnebel.
Emissionsnebel:
Orion-Nebel, M42, Sternbild Orion,

Emissionsnebel (H II-Regionen) sind auf lang belichteten Aufnahmen an
ihrer roten Farbe zu erkennen. Wenn energiereiches Licht extrem
heißer junger Sterne auf interstellares Gas trifft, kann es die
Wasserstoff-Ionen zum Leuchten anregen. Bei der
Rekombination freier Elektronen mit einem Wasserstoff-Ion wird eine
charakteristische Spektrallinie bei 656nm (H alpha-Linie) ausgestrahlt.
Dieses besondere Rot ist die häufigste Farbe im Universum und zeigt
uns die Orte, wo Sterne geboren werden.
Dunkelnebel:
Pferdekopf-Nebel, B33, Sternbild Orion,

Dunkelnebel sind räumlich begrenzte Wolken aus Staub und kaltem
Gas, die das Licht der dahinterliegenden Sterne so weit abdunkeln,
daß ein sternarmes oder ein sternleeres Gebiet vorgetäuscht
wird.
Planetarischer Nebel:
Ring-Nebel, M57, Sternbild Leier,

Ein Planetarischer Nebel entsteht, wenn ein Stern am Ende seiner
Entwicklung die äußere Hülle abbläst. Die
zum Leuchten angeregte Hülle dehnt sich mit hoher Geschwindigkeit immer weiter im Raum aus. In
vielen Fällen kann man den heißen Sternrest im Zentrum
erkennen.
Diese irreführende Bezeichnung geht auf frühere visuelle Beobachtungen
zurück, da diese Objekte selbst im Fernrohr klein erscheinen und den Planetenscheibchen ähnlich sahen.
Supernovareste:
Cirrus-Nebel, NGC6960, Sternbild
Schwan,
 Wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova
explodiert, verliert er einen großen Teil seiner Masse und
schleudert sie mit hoher Geschwindigkeit auf die umgebende
interstellare Materie. Die entstehenden Schockwellen lassen sich an den
filamentartigen farbigen Strukturen beobachten. Die unglaublich hohen
Temperaturen schmieden aus den Wasserstoff-Atomen neue Elemente,
auch schwerer als Eisen, die als Molekülwolke durchs Universum fegen.
Wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova
explodiert, verliert er einen großen Teil seiner Masse und
schleudert sie mit hoher Geschwindigkeit auf die umgebende
interstellare Materie. Die entstehenden Schockwellen lassen sich an den
filamentartigen farbigen Strukturen beobachten. Die unglaublich hohen
Temperaturen schmieden aus den Wasserstoff-Atomen neue Elemente,
auch schwerer als Eisen, die als Molekülwolke durchs Universum fegen.
Diese Elemente finden wir in unserem Sonnensystem und in uns selbst -
denn wir sind auch Sternenkinder, gemacht aus Sternenstaub.
Kugelsternhaufen:
Kugelsternhaufen, M13, Sternbild Herkules,

Kugelsternhaufen erscheinen als dichtgepackte, stabile Sternansammlung,
die bis zu einer Million Sterne enthalten. Es sind sehr alte Objekte
und finden sich in den Außenbezirken der Milchstraße. Sie
besitzen keine interstellare Materie und haben deshalb keine
Sternentstehungsgebiete.
Galaxien:
Andromeda-Galaxie, M31, Sternbild Andromeda,

Es sind fremde
Milchstraßensysteme oft in Form einer
Spiralgalaxie oder seltener in Form einer elliptischen Galaxie. Sie
haben Milliarden
Sterne, Offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen und die verschiedenen
o.g. Nebel. Spiralgalaxien besitzen oftmals zahlreiche, aktive H
II-Regionen
und Sternassoziationen. Gaslose elliptische Galaxien bestehen oft
aus alten Sternen ohne Sternentstehungsgebiete. Unser eigenes
Milchstraßensytem gehört zu den Spiralgalaxien und alle 6000
Sterne, die wir mit bloßen Auge sehen, gehören zu unserer
Heimatgalaxie.
Nebelkataloge für Amateur-Astronomen
Ein Nebelkatalog ist ein geordnetes Verzeichnis nebelhaft erscheinender Himmelsobjekte, in denen Angaben zu Positionen,
Helligkeiten, Größe, Entfernungen und Objektklassen gemacht werden. Die früheren Astronomen stießen in ihren Fernrohren immer wieder auf
diffuse Flecken und nebelhafte Gebilde, die im Gegensatz zu den
Planeten und Kometen ihre Stellung am Himmel nicht änderten. Die wahre Natur dieser nebelhaften Objekte war den früheren Astronomen noch unklar. Es gibt eine Vielzahl von historisch
gewachsenen astronomischen Katalogen. An
dieser Stelle sollen die für Hobby-Astronomen gebräuchlichen
Nebelkataloge vorgestellt werden.
Messier-Katalog

Charles Messier, französicher Astrononom und erfolgreicher "Kometenjäger"
(1730 bis 1817), legte ein Verzeichnis nebelhaft erscheinender
Himmelsobjekte für den nördlichen Sternhimmel an. In diesem Verzeichnis vermerkte er die gemessenen
Positionen und sichtbaren Eigenschaften, um zukünftige
Kometenbeobachtungen zu vereinfachen und um Verwechselungen zu vermeiden. Im Jahre 1784
veröffentlichte er das Verzeichnis, das später auf 110
Objekte erweitert wurde.
Die in dem Messier-Katalog gegebene
Nummerierung findet noch heute in den Messier-Nummern (M
mit nachfolgender Zahl) Anwendung. z.B. Krebsnebel M1, Orionnebel M42,
Unter Amateur-Astronomem ist
der
Messier-Katalog beliebt, da man die darin aufgeführten Objekte
bereits
mit relativ kleinen Teleskopen beobachten kann. Charles Messier
beobachtete meistens mit Refraktoren von ca. 90mm Öffnung und
1100mm Brennweite. Das ist eine Instrumentengröße, die heute
für jeden interessierten Amateur erreichbar ist.
Mit den heutigen Fernrohren und Beobachtungstechniken hat man die wahre
Natur der vermeintlichen Nebel entschlüsselt. So gelang es Edwin
Hubble im Jahre 1926 Einzelsterne in den Randgebieten
des Andromedanebels aufzulösen. Damit gelang der Nachweis,
daß dieser Nebel eine fremde Galaxie außerhalb unseres
Milchstraßensystems ist. Auch viele andere nebelhafte Gebilde, bei denen es sich in Wirklichkeit um galaktische Nebel, Sternhaufen oder um extragalaktische Sternsysteme handelt, sind zwischenzeitlich enttarnt worden:
M1 Krebsnebel = Supernovarest, M13 = Kugelsternhaufen, M42 Orionnebel
= Emissionsnebel, M45 Plejaden = Offener Sternhaufen, M51 = Galaxie
NGC-Katalog

Der wichtigste Nebelkatalog für die Fachastronomen ist der New
General Catalogue (NGC) , ein Katalog von galaktischen Nebeln,
Sternhaufen und Galaxien. Der dänische Astronom Johan Dreyer
stellte den NGC-Katalog zusammen und veröffentlichte ihn im Jahre 1888.
Der NGC-Katalog enthält, unter Verwendung der Beobachtungen von Wilhelm Herschel, 7840 Objekte.
Der NGC-Katalog wurde in den Jahren 1805 und 1908 um zwei Index-Kataloge (IC) erweitert.
Die beiden Index-Kataloge enthalten zusammen 5386 Objekte.
Die NGC- und IC-Kataloge werden ebenfalls gerne von Amateur-Astronomen verwendet, weil er viele
Objekte enthält, die mit Amateurteleskopen noch beobachtet
werden können.
So ergeben sich oftmals Mehrfachbezeichnungen eines Objektes:
Eigenname
Messier
NGC
Andromedanebel,
M31 NGC224
Ringnebel,
M57
NGC6720
M106
NGC4258




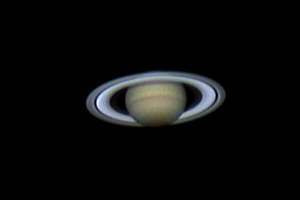 Saturn als zweit größter Planet im Sonnensystem gehört
zu den Gasplaneten. Er ist der sonnenfernste Planet,
der noch mit bloßem Auge gesehen werden kann und war schon im
Altertum bekannt. Als
Herr der Ringe ist er der bekannteste aller Planeten. Die erste
Live-Beobachtung im Fernrohr wird man so schnell nicht vergessen. Es
ist unglaublich, die Kugel des Saturns schwebt scheinbar
schwerelos in seinem Ring. Absolut edel! Der Planet hat was, er hat Stil!
Saturn als zweit größter Planet im Sonnensystem gehört
zu den Gasplaneten. Er ist der sonnenfernste Planet,
der noch mit bloßem Auge gesehen werden kann und war schon im
Altertum bekannt. Als
Herr der Ringe ist er der bekannteste aller Planeten. Die erste
Live-Beobachtung im Fernrohr wird man so schnell nicht vergessen. Es
ist unglaublich, die Kugel des Saturns schwebt scheinbar
schwerelos in seinem Ring. Absolut edel! Der Planet hat was, er hat Stil!



 Wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova
explodiert, verliert er einen großen Teil seiner Masse und
schleudert sie mit hoher Geschwindigkeit auf die umgebende
interstellare Materie. Die entstehenden Schockwellen lassen sich an den
filamentartigen farbigen Strukturen beobachten. Die unglaublich hohen
Temperaturen schmieden aus den Wasserstoff-Atomen neue Elemente,
auch schwerer als Eisen, die als Molekülwolke durchs Universum fegen.
Wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova
explodiert, verliert er einen großen Teil seiner Masse und
schleudert sie mit hoher Geschwindigkeit auf die umgebende
interstellare Materie. Die entstehenden Schockwellen lassen sich an den
filamentartigen farbigen Strukturen beobachten. Die unglaublich hohen
Temperaturen schmieden aus den Wasserstoff-Atomen neue Elemente,
auch schwerer als Eisen, die als Molekülwolke durchs Universum fegen.


